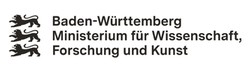Wer war Margots beste Freundin Emy?
Vom Umgang mit historischem Material im Schreiben. Autorin Viola Rohner im Gespräch mit Dramaturgin Romana Lautner
Romana Lautner: Was fasziniert dich an Margots Geschichte, speziell an ihrem 1939/40 geschriebenen Essay?
Viola Rohner: Faszinierend finde ich vor allem Margots scharfsinnige Analyse der deutschen Gesellschaft, die sich besonders im Essay zeigt. Ich bin überzeugt, wäre Margot nicht wegen der NS-Diktatur zur Flucht gezwungen worden, wäre sie eine der ersten deutschen Soziologieprofessorinnen geworden. Sie analysiert die damalige Gesellschaft, in der sie aufwuchs – auch die intellektuelle, jüdische Oberschicht, zu der ihre Familie gehörte –, auf so schonungslose Art, dass man kaum glauben kann, dass sie zu diesem Zeitpunkt erst 23 Jahre alt war.
Romana Lautner: Was glaubst Du war Margot für ein Mensch?
Viola Rohner: Margot war ein sehr fröhliches, lebenslustiges Kind. Sie hatte ein großes Sprach- und Schauspieltalent und war in jeder Klasse und später in ihrer Clique sehr beliebt, weil sie viel Humor hatte. Die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, ihnen manchmal auch auf entwaffnend direkte Art die Meinung zu sagen, hat ihr später in Italien, in England und auch in Amerika sehr geholfen. Sie konnte sich, ganz auf sich allein gestellt, durchboxen, spürte, wer ihr wohl gesonnen war und wer nicht, konnte schon früh gut für sich selbst sorgen.
Heute würde man sagen, Margot war ein Mensch mit enormer Resilienz. Das zeigt sich auch daran, dass sie es schaffte, an all dem Schrecklichen, das ihr widerfuhr, nicht zu zerbrechen und ein erfülltes Leben zu leben. „I was chosen to live“ lautet der bedeutsame Satz, den sie ihrer Autobiographie vorangestellt hat. Sie sagte sich nicht: Ich wurde nur mit viel Glück von den Nazis nicht ermordet. Sondern: Dass ich überlebte, ist ein Zeichen dafür, dass ich „auserwählt“ wurde zu leben. Es bedeutet für mich, dass ich mich dem Leben gegenüber als besonders „würdig“ erweisen muss. Für Margot hieß das, ihre Möglichkeiten voll auszukosten, etwa in der Liebe oder in der Kunst, und es hieß für sie, Verantwortungsbewusstsein zu zeigen – gegenüber ihren Kindern, ihren Studierenden, Nachbarn, Mitmenschen. Sie stellte sehr hohe ethische Anforderungen an sich selbst. Ich habe das Gefühl, auch ihre Autobiografie schrieb sie aus diesem Verantwortungsbewusstsein heraus: Sie wollte, dass nicht vergessen geht, was Menschen Menschen antun können und wie banal und leicht zu übersehen die ersten Anzeichen der Barbarei sind. Dass der Text vor fünfzig Jahren nicht publiziert wurde, weil es „zu viele solcher Berichte gibt“, war für sie sicherlich niederschmetternd.
Romana Lautner: Margot schreibt sowohl im Essay als auch in ihrer Autobiografie von ihrer Freundin Emy. Wir wissen, dass sie alle Namen verändert hat. Vermutlich, um sich selbst und andere vor Anfeindungen zu schützen. Warum war es dir als Autorin so wichtig, herauszufinden, wen Margot mit Emy gemeint hat?
Viola Rohner: Mich hat Emy von Anfang an besonders interessiert. Einerseits, weil sie die engste Freundin von Margot war, mit der sie wirklich alles teilte, und andererseits, weil Emys Geschichte viele Fragen aufwirft. Ich dachte, wenn ich mehr über die reale Emy herausfinden würde, könnte ich besser verstehen, warum sie sich nach 1934 immer mehr von Margot distanzierte und dem „Bund Deutscher Mädel“ beitrat und warum die beiden trotz allem, was passiert war, nach dem Krieg wieder gute Freundinnen werden konnten. Margot nennt sie in ihrer Autobiografie „my lifelong friend, Emy“. Ich konnte das nicht verstehen. Wie konnte Margot über die schweren Verletzungen hinwegsehen?
Romana Lautner: Was hast du herausgefunden?
Viola Rohner: Zuerst dachte ich, dass Emy mit Idl Raetz identisch ist, einer Freundin, die Margots Sohn Ronald in einem Zoomgespräch nannte. Er beschrieb Idl als gute Schulfreundin aus der Konstanzer Zeit, mit der Margot nach dem Krieg wieder in regem Austausch stand. Idl hätte Margot sogar in den USA besucht und Margot hätte Ferien in Idls Ferienhaus auf der Belle-Île in Frankreich verbracht. Im Staatsarchiv in Konstanz fand ich ein altes Adressbuch und den Eintrag: Ida Emma Raetz, Gottlieber Strasse 13. Ich nahm daher an, Margot habe den zweiten Namen von Idl als Pseudonym gewählt. Ich hatte großes Glück und fand gleich mehrere Menschen, die mir Auskunft gaben. Idl sei ein besonders hilfsbereiter und weltoffener Mensch gewesen, habe nach dem Abitur eine Ausbildung als Chemietechnikerin gemacht und sei nach dem Krieg von ihrem Betrieb nach Paris versetzt worden. Konstanz gehörte ja zur französischen Besatzungszone. Sie habe später als Übersetzerin und als „Person für alles“ am Deutschen Historischen Institut in Paris gearbeitet, das sich auch mit Wiedergutmachungsangelegenheiten beschäftigt habe. Idl habe sich zeitlebens für Menschen, die in Not waren, eingesetzt. Sie habe unzählige Briefe geschrieben, für Leute Arbeitsstellen gesucht, Geld organisiert, Zahnarztrechnungen bezahlt. Ihre Schreibmaschine habe unentwegt geklappert, selbst, wenn sie in den Ferien war. In meinem Kopf verdichtete sich sofort das Bild einer Emy, die auf diese Weise versucht hat, ihre Schuld abzuarbeiten.
Wenig später fand ich aber im Staatsarchiv Konstanz mit Hilfe von Lehrer Benjamin Biesinger die Klassenlisten aller Schülerinnen, die an der Friedrich-Luisen-Schule im Jahr 1933 Abitur gemacht hatten. Ida Emma Raetz war in der Parallelklasse von Margot Spiegel. In Margots Klasse war jedoch ein Mädchen mit dem Namen Emilie Moosbrugger gewesen. Und alles, was ich in der Folge über Emilie Moosbrugger herausfand, stimmte mit den Angaben in Margot Spiegels Autobiografie weitgehend überein. Sie hatte einen pensionierten Grundschullehrer zum Vater, der 1935 verstarb, hielt die Abiturrede im Jahr 1933 und erhielt die Auszeichnung aufgrund hervorragender Noten, die Margot hätte erhalten sollen. Ich war nun sicher Emilie Moosbrugger war Emy, nicht Idl Raetz. Das Rätsel hatte sich gelöst. Doch leider verliefen alle meine weiteren Recherchen zu Emilie im Sand. Ich fand einzig heraus, dass Emilie Moosbrugger 1937 nach Offenburg gezogen war und dass ihre Mutter Anna bis 1962 weiter an den Beethovenstrasse 29 in Konstanz gewohnt hatte.
Ich konnte nicht herausfinden, was aus der realen Emy nach dem Krieg wurde und wie sie mit Margot wieder in Kontakt kam. Aus diesem Grund entschloss ich mich, die Figur der Emy aus Ida Emma Raetz und Emilie Moosbrugger zu einer einzigen Figur zu verschmelzen. Emilie wurde zur Vorlage für Emy vor dem Krieg und Idl die Vorlage für Emy nach dem Krieg.
Romana Lautner: Warum glaubst Du, haben die beiden ihr Leben lang Kontakt gehalten?
Viola Rohner: Diese Frage habe ich auch Margots Sohn Ronald gestellt. Er meinte, es habe eine Entschuldigung von Emy gegeben, die den Kontakt nach dem Krieg wieder möglich gemacht habe. Die meisten anderen ehemaligen Freund*innen aus der Konstanzer Zeit hätten nicht geschrieben oder wenn sie schrieben, nur beteuert, dass sie selber Opfer des Naziregimes gewesen seien. Einige warfen seiner Mutter sogar vor, dass sie es in Amerika viel besser gehabt habe als die Deutschen, die den Krieg hätten durchmachen müssen.
Ich denke aber, dass auch Margots offene, lebensbejahende Persönlichkeit und ihre Überlebensstrategie, „nicht zurückschauen“, eine Rolle gespielt haben. Das Beispiel von Emy und Margot zeigt, dass Vergebung auf einer persönlichen, individuellen Ebene möglich, jedoch auf einer gemeinschaftlichen respektive staatlichen Ebene unmöglich ist. Nichtsdestotrotz ist jede Form der angestrebten Wiedergutmachung auch auf der gesellschaftlichen Ebene extrem wichtig.
Romana Lautner: Du hast kein dokumentarisches Stück geschrieben und dennoch verwendest Du viel Originaltexte und hast viel recherchiert. Wie hoch, würdest Du sagen ist der Anteil an Fiktion?
Viola Rohner: Ich würde sagen, der Anteil der Fiktion ist sehr klein. Vielleicht 20%. Ich habe sehr viel recherchiert und meine Figuren und ihr Verhalten ausgehend von meiner Recherche kreiert. Dazu kommen die erzählenden Teile, die original aus dem Essay oder der Autobiographie entnommen sind.
Natürlich gibt es Dinge, die ich komplett erfunden habe. Zum Beispiel die Rivalität von Margot und Emy um Ferdi. Margots erster Freund, in den sie sehr verliebt gewesen war, war tatsächlich ein Katholik. Aber er wurde später nie Emys Freund. Ich wollte mit dieser Episode vor allem zeigen, wie eine Liebschaft bei Margot oft in die nächste überging, und manchmal liebte sie wohl auch zwei oder drei Jungs gleichzeitig. Sie war eine sehr lebenslustige junge Frau, die sich auch danach sehnte, ihre Sexualität auszuleben. Diese Fähigkeit, sich leicht zu verlieben, hat ihr später nach ihrer Flucht nach Amerika sehr geholfen. Sie war eine wichtige Quelle der Resilienz.
Romana Lautner: Du hast, noch bevor Du mit dem Schreiben begonnen hast, mit sechs Schulklassen den Essay gehört und darüber gesprochen. Wie sehr hat dich das im Schreiben beeinflusst?
Viola Rohner: Es waren alles extrem spannende Gespräche. Mir wurde vor allem bewusst, wie wenig die Schüler*innen über den Alltagsrassismus wussten, dem jüdische Menschendamals ausgesetzt waren. Die meisten Jugendlichen hatten wenig Kenntnis darüber, wie perfide die nationalsozialistische Ideologie verbreitet wurde, wie die Mechanismen der Ausgrenzung funktionierten, welche Wirkung sie auf die jüdische Bevölkerung bis ins Innerste hatten. Die Schüler*innen dachten mehr oder weniger, dass jüdische Menschen von einem Tag auf den andern in die Konzentrationslager deportiert worden waren. Von der (jahrhunderte)langen Vorgeschichte der Ausgrenzung hatten sie kaum Kenntnis.
Ich wollte den Fokus darum stark auf dieses Thema legen, weil es die Jugendlichen selbst nach der Lektüre von Margots Essay am meisten interessierte. Vermutlich auch, weil das Thema Ausgrenzung in ihrem Alltag genauso präsent ist. Beeinflusst vom damals aktuellen amerikanischen Wahlkampf wünschten sie sich aber auch, dass ich zeige, wie Hitler an die Macht kam. Wie schnell die Demokratie abgeschafft werden kann, wenn man nicht aufpasst. Ein drittes Thema, das sie sehr interessierte, und dem ich im Stück dann nur wenig nachgehen konnte, ist das Thema der individuellen Verarbeitung des Holocausts. Wie konnte Margot, deren ganze Familie in Ausschwitz ermordet worden war, weiterleben? Was gab ihr die Kraft? Ich hätte diesen Aspekt gerne größer gemacht, weil er mich selbst sehr interessiert, aber das Stück wäre zu lang geworden. Margots „Weiterleben“ in Amerika musste ich weglassen. Dass die Kunst für sie eine wichtige Quelle der Verarbeitung gewesen war, ist in der Inszenierung nur noch in Form einer ihrer Teppiche präsent.
Romana Lautner: Wie sehr haben sich da die Gespräche in der Schweiz und in Deutschland unterschieden?
Viola Rohner: Ich fragte die Schüler*innen in beiden Ländern danach, ob über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust in ihren Familien geredet werde. Und was man sich erzähle. Mir fiel auf, dass man sich in Deutschland im Gegensatz zur Schweiz mehr persönliche Geschichten erzählte. Man bewahrte Briefe des Urgroßvaters von der Front auf, man erzählte Geschichten vom Krieg. Ein Schüler erzählte mir, dass der Urgroßvater ein Kommunist gewesen sei, der im KZ inhaftiert gewesen sei. Viele Schüler*innen meinten aber, es werde gar nichts erzählt in ihren Familien, niemand würde mit ihnen über die Geschehnisse sprechen. In der Schweiz gab es kaum solche persönlichen Erinnerungen.
Bei den Gesprächen in der Kantonschule Baden war interessant, dass sehr viele Jugendliche dort zur Schule gehen, deren Eltern aus verschiedenen Ländern eingewandert sind. Die Auswirkungen und der Einfluss des NS-Regimes auf die Länder außerhalb Europas ist erst wenig erforscht und darum in den Familien nicht oder nur wenig präsent. Eindrücklich fand ich aber, wie differenziert die Jugendlichen in diesen Klassen über Mechanismen der Ausgrenzung allgemein diskutierten. Sie schienen sie sehr gut aus ihrem Leben zu kennen. Über sich persönlich wollten sie aber nie sprechen. Alles, was sie mir erzählten, passierte „anderen“. Es schien eine Art Schutzmechanismus zu sein, die eigene Ausgrenzung oder die ihrer Familien nicht zum Thema zu machen.
Romana Lautner: Wie sehr haben dich die aktuellen politischen Ereignisse beeinflusst? Hast du deshalb Margot Friedländer mit hineingenommen, eine Überlebende, die anders als Margot, noch bis dieses Jahr gelebt hat?
Viola Rohner: Die aktuellen Ereignisse haben mich sicherlich stark beeinflusst. Der Wahlkampf in Amerika, der Sieg Trumps, die Zunahme der rechten Ideologien in Europa und in Israel. So vieles, was Margot schrieb, könnte in der heutigen Zeit geschrieben worden sein. Und natürlich wollte ich die Parallelen aufzeigen. Bemerkenswert ist aber, dass diese rechten Ideologien heute so viel Zuspruch haben, obwohl die wirtschaftlichen Verhältnisse erstaunlich stabil sind. Das sollte uns zu denken geben – auch im Kampf gegen sie.
Den Ausschnitt aus einer der Reden von Margot Friedländer habe ich am Schluss darum angefügt, weil Friedländer eine sehr universale Auffassung von Menschlichkeit und von Humanismus hatte. Diese Auffassung teilten nicht alle Holocaust-Überlebenden. Und Margot Spiegel selbst äußerte sich dazu nicht. Sie sah im Wesentlichen die breite Bildung der Bevölkerung – auch in den entlegensten Gebieten – als wichtigstes Mittel im Kampf gegen menschenverachtende Ideologien.
Das Gespräch mit Viola Rohner fand am 30.09.2025 statt.